Die Verwandtschaft von Tourist und Detektiv — über Krimis am falschen und am richtigen Ort
Erzählte Verbrechen gehören zum mythischen Grundhaushalt der modernen Metropolen. So wie das Phantom durch die Keller der Oper schlurfen muss, um die Erinnerung an die Nachtseiten der Kunst wach zu halten, so erscheint uns eine große Stadt ohne Detektive und Kriminelle unvollkommen, einfach zu gut, um Metropole zu sein. Dabei geht die Faszination nur ausnahmsweise von den tatsächlich begangenen Verbrechen aus. Es sind vorzüglich Kriminalromane, deren Fiktionen den Subtext zum kollektiven Bild der großen Stadt liefern. Je weniger die Erfindung mit der Wirklichkeit zu tun hat, desto wirksamer ist sie oft.
Und schafft eigene Tatsachen: Bekanntlich hat Conan Doyle das Haus 221B Baker Street niemals bewohnt und vermutlich nicht einmal gesehen. Und doch pilgern Hunderte Besucher täglich in das dort eingerichtete Museum, um sich an den artifiziellen Hinterlassenschaften Sherlock Holmes‘ und Dr. Watsons zu ergötzen. Auch wenn hier der Mythos noch nicht in Teak und Plüsch geronnen ist, wären Los Angeles ohne Ross McDonald und James Ellroy, San Francisco ohne Dashiell Hammett oder Barcelona ohne Vázquez Montalbán nicht die Städte, die wir kennen.
Obwohl die literarische Form des Krimis (in der Regel) den Tat-Ort verlangt, ist es nicht der Innovationslust der Autoren, sondern eher außerliterarischen Ursachen zu verdanken, dass sich in den 160 Jahren Krimigeschichte die Schauplätze aufs weite Land, auf Inseln, Wüsten und die Dörfer ausgedehnt haben. Mit der Durchsetzung kapitalistischer Wirtschaftsformen universalisierte und differenzierte sich auch das literarische Verbrechen.
Von Jerry Cotton zum Mallorca-Krimi
Anschaulich zeigt das die Nachkriegsgeschichte der deutschen Krimiliteratur. In den nicht gerade spielfreudigen Wiederaufbaujahren gingen nur Importhelden à la Jerry Cotton oder Nick Knatterton durch (beide von deutschen Autoren geschrieben). Erst mit den sozialkritischen neuen deutschen Krimis gerieten um 1968 (west)deutsche Verhältnisse in den Blick. In der Mitte der achtziger Jahre erhob dann die gedemütigte Provinz ihr Haupt. Geadelt durch das Subgenre des Regionalkrimis, zählten hinfort Köln, Düsseldorf oder sogar die Eifel als Verbrechensstätten.
Und nun sind auch die Urlaubsziele der Deutschen krimifähig geworden. Geradezu Programmliteratur in diesem Sinne schreiben Jürgen und Marita Alberts, die sich seit 1985 von der Toskana über Patros und die Algarve nach Teneriffa durchgearbeitet haben.
Auf dieser Kanareninsel findet auch ein Immobilienhai namens Kummer sein verdientes Ende: In Teneriffas tödlicher Preis haut ihm die betrogene Investorin Masten eine Glasplastik der Kanarischen Inseln über den Schädel, die das Autorenduo symbolträchtig in ihre Griffnähe platziert hat. Dieser und 23 weitere Minikrimis sind in der Anthologie Bei Ankunft Mord versammelt, meistens mitten aus dem Urlaubsalltag gegriffen. Da rauscht ein nutzlos gewordener Ehemann die Gießbachfälle hinab (Peter Zeindler: Flucht ins Berner Oberland), oder zwei Tramperinnen erwehren sich erfolgreich eines bulligen Aussies, der es liebt, deutsche Blondinen in den versifften Stauraum seines Wohnmobils zu pferchen, mittels eines Schweizer Taschenmessers (Birgit H. Hölscher: Die Piste der toten Kängurus).
Bei Ankunft Mord – und dann doch noch einmal davongekommen: Wohin mit der aus dieser Spannung gelösten Energie? Statt sie als freie Radikale loszulassen, lenken die Herausgeberinnen der Anthologie sie um auf Reiseziele. Jede Short Story mündet in touristische Insidertipps. Auch wenn die Sammlung etliche spannende Geschichten und manche ganz nette Veräppelung touristischer Klischees enthält, ist sie enttäuschend. Daran ändert auch die schöne Ausstattung nichts. Die auf den ersten Blick hübsche Idee der Anthologie erweist sich als trügerisch. Es reicht nicht, spannende Story und Ortsangabe nur aneinander zu koppeln. Diese schlichte Verbindung trägt nicht weit, weil sie – die literarische Qualität der Texte einmal ausgeklammert – den Leser gering achtet.
Zwei seiner Seelen, die detektivische und die reiselustige, werden zwar angesprochen, aber missverstanden.
Seelenverwandt: Tourist und Detektiv
Vielleicht liegt das daran, dass bisher die strukturelle Seelenverwandtschaft zwischen Tourist und Detektiv kaum erforscht ist. Wie dem Detektiv erscheint auch dem Touristen vieles rätselhaft. Beide müssen sogar, wollen sie ihre Daseinsbestimmung erfüllen, auch dort Rätselhaftes finden, wo andere Mitmenschen nur Alltägliches erkennen können. Ihre Erkundungsmethoden sind tentativ: Ständig wechseln sie zwischen induktiven und deduktiven Verfahren, Intuition ist oft ausschlaggebend. Sie müssen sich die Topografie der Tat- und Urlaubsorte erschließen, müssen den geheimnisvollen Umgangsformen und Beziehungen unbekannter Menschen auf die Spur kommen und dabei Mauern aus Abwehr, Lüge, Verstellung und Betrug überwinden. Beide suchen etwas, von dem sie nur wissen, dass es vorhanden ist, aber nicht, was es genau bedeutet: der Tourist die Sehenswürdigkeit, der Kriminalist das Beweisstück. Beide halten sich auch nur vorübergehend am Schauplatz des Geschehens auf: Der Detektiv übernimmt einen nächsten Fall, der Tourist reist heim.
Und: Beiden gemeinsam ist die Neugier. Der Tourist wie der Detektiv sind Schnüffler. Sie stecken die Nase in Angelegenheiten, die sie eigentlich nichts angehen, und bekommen manchmal dafür eins drauf. Im besten Fall entdecken sie dabei Unerwartetes, Aufregendes, Neues.
Hier kommt wieder der Leser ins Spiel. In der Identifikation mit der literarischen Figur des Detektivs und in der Übernahme der sozialen Rolle des Touristen kann er seine Entdeckungslust und Neugier nach eigenen Maßstäben ausleben. Als Tourist erlebt der Leser kleine Abenteuer und sammelt beschränkte Entdeckungserfahrungen. Dabei dient ihm die Fantasiefigur des Detektivs als Vorbild. Denn in gewisser Hinsicht ist der Detektiv ein ins Fiktionale radikalisierter Tourist: Er überschreitet die Grenzen, die der Urlauber auch gern übertreten würde, hielten ihn nicht Fremdenangst und Sicherheitsbedürfnis zurück.
Kriminalromane mit lokalisierbaren Schauplätzen wecken nun den Detektiv im Leser ganz unmittelbar. Indem er als Tourist den Tatort aufsucht, kommt er dem Autor, dem beneideten Urdetektiv, auf die Spur: Schnüffler-Glück des Nachvollzugs. Um dem Kriminalgeschehen folgen zu können, hat der Leser bereits bei der Lektüre Beweise gesucht und Raum rekonstruiert. Diese Nacherfindung im Leserkopf wird beim Besuch des realen Tatorts verdoppelt durch sinnliche Erfahrung: Aha! So schmeckt also „in Seehundöl getunkter Fisch“ in Alaska. Bereits die Aussicht auf diese Begegnung im Realen steigert die spannende Leseerfahrung um Schauder und Lust der Vorfreude.
Auf diesen Reiz setzt nicht nur die Anthologie Bei Ankunft Mord. Als weiteres Beispiel eines Urlaubsparadies-Krimis sei Michael Böcklers „Toskana-Roman“ Wer stirbt schon gerne in Italien? genannt. Die blasse Story ist mit Reiseführer-Elementen garniert. Der Charme solcher Schmöker trägt so weit wie das Lächeln eines Barkeepers. In ihnen dient der Schauplatz kaum zu mehr als zur Kulisse, die
Krimihandlung könnte genauso gut woanders spielen, und ihr Unterhaltungswert entspricht dem touristischer Animationen, die den Urlaubern die Langweile erträglich machen sollen.
Kriminalromane als poetische Ortsentschlüsselung
Kriminalromane hingegen, die in den Mythos einer Stadt oder Region eingehen, entwickeln eigene literarische Wucht. Nicht die Lokalität als solche bildet den doppelten Boden zur Erzählung. Das ist der Trugschluss in Bei Ankunft Mord et cetera. Um Fantasie, Neugier, Innenraum zu wecken, bedarf es künstlerischer Doppelbödigkeit. Der Krimikritiker Thomas Wörtche expliziert die erforderliche Qualität am Beispiel Georges Simenons: „Simenons Milieuschilderungen sind weniger dazu angetan, ‚echte‘ Bilder von Paris nachzuzeichnen, als Bilder von Paris zu entwerfen und durch die Art ihrer ästhetischen Eindrücklichkeit nachgerade festzuschreiben.“
Dieser Gedanke ist Programm geworden in der Taschenbuchreihe Metro. Sie erscheint im Zürcher Unionsverlag und wird von Thomas Wörtche herausgegeben. Ihr Start war fulminant. Auf einen Schlag tauchten im Frühjahr zwölf deutsche Erstausgaben am Krimihimmel auf, jedes Buch spielt an einem anderen Schauplatz: in Alaska, Honkong, Bangkok, Oslo, Marseille, Westafrika, Kuba und Harlem, in England. Noch erstaunlicher als diese verlegerisch-logistische Leistung ist die Entdeckung unbekannter Autoren. Das Konzept, spannend von der Welt zu erzählen, bringt eine unverhoffte Vielfalt hervor: Beinahe in jedem Titel ist eine Besonderheit oder Innovation moderner Kriminalschriftstellerei zu entdecken. Der Unionsverlag hat seine ganze Erfahrung mit der Übersetzung wenig bekannter Literaturen aus der Zweiten und Dritten Welt in die Waagschale geworfen.
Wer glaubt, gute Krimis könnten nur in den westlichen Industrieländern entstehen, in jenen melancholischen Zonen, in denen Aufklärung nur noch eine müde Erinnerung ist und Gerechtigkeit ein schaler Witz auf Fund-Raising-Partys, sollte sich Mongo Betis SONNE LIEBE TOD zu Gemüt führen. Seit seinem Debüt 1954 gilt der in Kamerun geborene Mongo Beti als unversöhnlicher Gegner des französischen Neokolonialismus und seiner afrikanischen Kumpel. Im französischen Exil unterrichtete Beti als Gymnasiallehrer Latein und Griechisch, erst als Pensionär kehrte er 1992 nach Kamerun zurück.
Dort irgendwo, in einem namentlich nicht bezeichneten westafrikanischen Land, wird dem Journalisten Zam die Sammlung mit über hundert Jazz-CDs geklaut. Bald verschwindet seine geliebte Bébète, ein katholischer Priester wird massakriert. Als dann noch eine Leiche in Zams Wohnung gefunden wird, bricht sein mit billigstem Whisky, Côtes du Rhône und Bier errichteter Schutzschild gegen die Wirklichkeit zusammen: Der Journalist macht sich notgedrungen auf die Suche nach der Quelle aller dieser Übel. Eine Recherche, die von Flucht kaum zu unterscheiden ist, führt ihn in die Villa einer grauen Eminenz der Regierung, wo als Staatsgeheimnisse die Lustknaben etlicher weiterer Exzellenzen gefangen gehalten werden. Irgendwann begreift Zam: Alles diente einem stinknormalen Wahlkampf. Vollends grotesk wird die schwarze Politsatire durch Betis in gewähltestem Akademie-Französisch swingenden Erzählstil. Man möchte am liebsten mitsingen, -trommeln, -tanzen.
Zwischen den politischen Sümpfen Kameruns und dem düsteren Blues von Marseilles Einwandererviertel um die Rue Panier liegen nur sechs Titelnummern. Beti hat Nr. 172, Jean-Claude Izzos TOTAL CHEOPS Nr. 164. „Marseille ist keine Stadt für Touristen. Es gibt dort nichts zu sehen.“ Die Geschichte, die Izzo mit der Geschmeidigkeit und Modulationsbreite eines Jazzsolisten erzählt, handelt vom Zerbrechen einer Jugendfreundschaft. Drei Jungen und ein Mädchen, jeder aus einer anderen nationalen Katastrophe an die Piers von Marseille gespült, schlagen sich durch: gegen Ausbeuter, Bullen, Mafia, Fremdenhass, elterliche Engstirnigkeit. Irgendwann zerbricht die Kameradschaft an der Liebe, einer von ihnen, Fabio Montale, wird Polizist. Nun muss er – Jahre später – den Tod seines zurückgekehrten Freundes aufklären und zurücksteigen in die Verwerfungen ihrer Vergangenheit. Mit Fabio Montale hat Izzo die Figur des melancholischen Einzelgänger-Detektivs um die Variante des exilierten traurigen Clowns bereichert, eine Figur, wie sie nur in den nach Fisch und Schweiß riechenden Hafenvierteln Marseilles entstehen kann.
So wie der im Januar verstorbene Izzo mit seiner Montale-Trilogie (zwei Bände folgen) zum Simenon Marseilles geworden ist, so steht Chester Himes für Harlem. In PLAN B, seinem letzten Roman, entwirft er die gewalttätigste schwarze Verschwörung, die je literarisch ausgedacht wurde. In den grellen Crashs seiner Szenen explodieren die durch Rassismus aufgestauten Gefühlsenergien in unerträglicher Gewalttätigkeit.
Mit TEMUTMA haben Rebecca Bradley und Stewart Sloan ein Monster geschaffen, das dem Turbowahnsinn der Hypermetropole Hongkong selbst entsprungen scheint. Tief in den Kellern des ältesten Stadtteils von Kowloon haust es. Nur stärkste magische Kräfte konnten es über die Jahrtausende gebändigt halten. Als das Viertel – hier verknüpft sich die Vampir- und Schauer- mit der tatsächlichen Stadtgeschichte – abgerissen werden soll, gelingt es Temutma zu entweichen. Horror über der Stadt. Bisher spiegelte Hongkong sich in den aberwitzigen Romanen William Marshalls. Jetzt haben Bradley/Sloan der Königin am Pearl-Fluss mit ihrem genresprengenden Erstling ein anderes, ein tollwütiges Gesicht gegeben.
Könnte Temutma die Eifel terrorisieren? Rhetorische Frage. Städte gibt es, die sich ihre Schriftsteller suchen. Man muss sie nur den Lesern vorstellen. Dann können wir zu Hause bleiben und lesen.
Beitrag zum Milleniums-Sommer in der ZEIT 36/2000

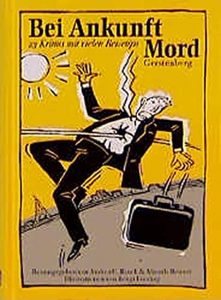


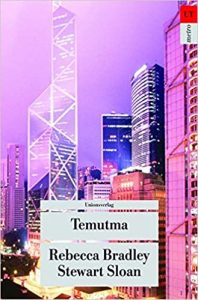
Schreibe einen Kommentar