Friedrich Ani quittiert den Dienst und spricht über Freud und Leid an der Kriminalliteratur*
Friedrich Ani, geb. 1959, ist einer der besten deutschen Kriminalschriftsteller. Für seine Romane um Tabor Süden, Hauptkommissar in der Vermisstenstelle der Münchner Kriminalpolizei, wurde er mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Deutschen Krimipreis 2003.
Im Juni ist mit „Süden und der Mann im langen schwarzen Mantel“ der letzte Band der auf zehn Titel angelegten Serie erschienen und gleich auf Platz Zwei der KrimiWelt-Bestenliste gelandet.
Mit Ani, der keine Kriminalromane mehr schreiben will, sprach Tobias Gohlis.
GOHLIS: Friedrich Ani, was machen Sie gerade?
ANI: Ich überarbeite die erste Fassung meines neuen Romans. Der Arbeitstitel lautet: „Memoiren eines Ungeborenen“. Ganz schön irre, was man da zusammenschreibt.
GOHLIS: Kein Krimi?
ANI: Nein, das ist der erste Roman mit einem Schriftsteller als Held.
GOHLIS: 1995 kam Ihre erste Kriminalerzählung heraus, jetzt, praktisch zum zehnjährigen Jubiläum, quittieren Sie den Dienst, nachdem der letzte Band der Reihe um Kommissar Tabor Süden und die Münchner Vermisstenstelle des Dezernats 11 erschienen ist. Wie sind Sie zum Kriminalroman gekommen?
ANI: Nach einer langen ersten Phase mit Gedichten und Erzählungen hatte ich meinen Stil und meine Charaktere gefunden. Acht Jahre lang hab ich an meinem ersten Roman „Das geliebte süße Leben“ herumgekürzt. Als der 1996 raus war, war ich völlig ratlos, so ratlos, dass ich mich in einen Auftrag vom Emonsverlag geflüchtet hab. So’n Münchenkrimi, mei, hab ich gedacht, was soll ich denn über München schreiben. Dann hab ich mich wie der Trinker in die Schwemme vor dem Hofbräuhaus, der darin ja auch vorkommt, in die Geschichte gestürzt, drei CSU-Leute umbringen lassen, folkloristische Elemente verwendet, was mir bis dahin vollkommen fremd war.
Ani und die Vermissungen
GOHLIS: Dabei haben Sie den Krimi als Genre ja nie so richtig als Ihren Fall angesehen, sondern immer versucht, Ihren Fall von Krimi zu gestalten.
ANI: Das war eine bewusste Entscheidung, dass ich mir eine Vermisstenstelle ausgesucht hab. Diese Geschichten waren mir einfach nahe: Da wird nach jemand gesucht, der weggehen will. Mir war es egal, ob das jetzt Krimi ist oder nicht.
GOHLIS: Und daraus ist eine ganz neue Sorte von Kriminalroman geworden: Nicht die Ermordeten sind der Ausgangspunkt, sondern die Vermissten, die ja noch leben können.
ANI: Damit hab ich mich erst später beschäftigt, dass das etwas Eigentümliches ist. Das hab ich weder angestrebt noch mir als bewusste Anders-Haltung vorgenommen.
Ani und der deutsche Krimi
GOHLIS: 2003 haben Sie Ihren Entschluß, keine Krimis mehr schreiben zu wollen, unter anderem so begründet: „Die Welt des deutschen Krimis scheint mir viel zu eng. Autoren schreiben ihre Heimatromane im Kleid eines Krimis.“ Sehen Sie das heute auch noch so?
ANI: Ich liebe diesen Tabor Süden, ich bin ihm wesensverwandt. Insofern bin ich dem Genre und der Umgebung dankbar und fühle mich auch zugehörig. Aber in den Jahren, in denen ich den deutschsprachigen Kriminalroman kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass mir das zu wenig ist, zu nebenbei, zu wenig Erzählung vom Menschen. Ich kann das nicht kleiner sagen.
Ich nehme den Krimi total ernst als literarische Gattung. Da erwarte ich Sprache und Musikalität und Empathie und einen Blick auf den Menschen, so wie er in seinem Zimmer und im Finstern ist.
GOHLIS: Welche Krimiautoren sind Ihre Vorbilder? Simenon sicherlich. Wenn Ihre Kommissare sagen „Ich verhöre nicht, ich vernehme“, dann erinnert das an …
ANI: . Simenons Maxime „nicht urteilen, nur verstehen.“ Ja, das ist eine Meßlatte, da kommt kaum jemand heran.
Neulich habe ich neue Geschichten von James Ellroy gelesen, auch autobiographische. Eine heißt „Wo ich meinen wilden Scheiß herhab“. Da erzählt er wieder, wie seine Mutter ermordet wurde und wie sich das in seinem Kopf und Herz eingepflanzt hat. Ellroy müßte für Mordgeschichten-Autoren die oberste Instanz sein: Wie man das Autobiographische mischen muss mit der Erzählung.
GOHLIS: Weil man sonst die nötige Intensität nicht erreicht?
ANI: Genau. Es geht um Leben und Tod. Wenn man das so richtig dostojewskimäßig ernstnehmen würde, dürften viele Krimis in Deutschland gar nicht erscheinen. Für viele ist das nur Spielerei. Ich glaube, der Kriminalroman als Spielerei funktioniert nicht.
Ani und das geschlossene Zimmer
GOHLIS: Jetzt im Gespräch und auch in Ihren Büchern taucht immer wieder das Bild vom geschlossenen Zimmer auf. Ist das die Vorstellung, die Sie geleitet hat?
ANI: Absolut. Eine Person in einem verschlossenen Raum, ein Fenster, eine Tür. Durch das Fenster dringt die Wirklichkeit erbarmungslos herein. Die Person weiß, dass sie nicht überleben wird, wenn sie es nicht schafft, die Tür zu öffnen und über die Schwelle zu treten. Das ist ein großer Akt, wenn jemand das schafft, und das verlangt zunächst ein Verstummen, eine Anerkennung. Niemand begreift das besser als Tabor Süden.
GOHLIS: Das ist zugleich der Akt der Selbstrettung des Schriftstellers.
ANI: Absolut. Das geht so weit, dass der Tabor Süden im letzten Roman nicht nur als Leser auftritt – das kennt man schon -, sondern als ein Schreibender, den das Schreiben vielleicht sogar gerettet hat.
Ani und der zehnte Roman
GOHLIS: Nach seiner Kündigung sitzt Süden im Hotel und widmet alle diese Ich-Erzählungen seiner verschollenen Jugendliebe Bibiana. Warum ist Ihnen der letzte der 10 Romane so wichtig?
ANI: Die Geschichte ist ganz nah am Tabor Süden. Ich hab versucht, einen Blick in seinen Maschinenraum zu werfen, ihn zu beschreiben, wie ich ihn sehe, von außen bis ins tiefste Innere.
GOHLIS: Süden ist noch einmal voll da, mit seinem Schweigen, das alle zum Reden bringt, mit seiner geradezu unheimlichen Intuition. Aber er geht unter, hat das „bezahlte Scheitern satt“. Wollten Sie ihn als starken Untergeher zeichnen?
ANI: Ich sehe ihn nicht als Untergeher. Das ist ein Mann, der seine Polizeiarbeit ernst nimmt, der weiß, was er tut und wie er seine Fähigkeiten einsetzen kann. Der läßt sich nicht von Gefühlen lenken, und auch das Intuitive setzt er bewußt ein. Das ist kein esoterischer, abgefahrener Typ, obwohl er auch seine indianischen Momente hat. Ursprünglich sollte die Reihe ja „Der Seher“ heißen, aber das war dann zu castañedamäßig.
Ani und der Abschied
GOHLIS: „Süden“ ist also eine Ableitung von „Seher“?
ANI: (lacht) Nein, das ist ein ganz alter Name, den habe ich schon als Jugendlicher für meine ersten Erzählungen erfunden. Ich hab gedacht, das wird später mal mein Pseudonym.
GOHLIS: Im letzten Roman demissioniert Tabor Süden. War dieses Eingeständnis des Scheiterns schon geplant, als Sie mit der Süden-Reihe anfingen?
ANI: Ja, denn die zehn Taschenbücher sind ja nach dem Roman „Erfindung des Abschieds“ (1998) konzipiert worden, in dem Südens bester Freund Martin Heuer Selbstmord begeht. Sie erzählen von der Zeit davor. So sind alle Romane geprägt von einer Schwermut, die von Anfang an wie eine Wolke am Horizont hing.
GOHLIS: Teilen Sie Südens Schwermut?
ANI: Der ist ein ganz harter Melancholiker – ich bin das nicht.
Unredigiertes Manuskript, Veröffentlichung in Der Literarischen Welt vom 25.6.05
Eine Bibliogafie der ersten zehn und weiterer Süden-Romane ist hier zu finden.
*Nachbemerkung 2021: Friedrich Ani hat den Dienst nicht quittiert und noch viele weitere Kriminalromane geschrieben, auch mehrere, in denen Tabor Süden eine Rolle spielt.


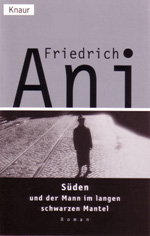
Schreibe einen Kommentar