Susanne Saygin wurde am 29.3.2019 mit dem Wittwer-Thalia Debütkrimipreis 2019 für ihren Erstling FEINDE vor 300 Krimifans im Stuttgarter Wilhelma-Theater ausgezeichnet. Die Laudatio:
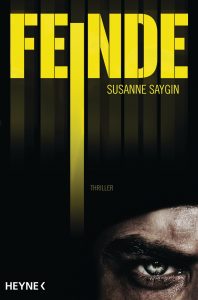
Als Susanne Saygin eines Morgens im Jahre 2009 in Köln-Ehrenfeld aufwachte, wurde ihr klar: ihre Welt hatte sich verändert. In das Nachbarhaus, in dem nur Platz für 80 Personen war, waren 250 bulgarische Roma eingesickert. Sie machten Krach und Müll, sie rochen schlecht, und Susanne Saygin machte eine verstörende Erfahrung. Ihre in sorgsamer Distanz zu überbevölkerten Häusern entwickelte politisch korrekte, wie sie sagt „unreflektierte Pro-Multi-Kulti-Haltung“ fiel in sich zusammen und wich sehr emotionalen, unkontrollierten Fluchtgedanken. Political correctness schlug, mit der Realität konfrontiert, um in Abscheu und sogar Hassgefühle.
Das war die Urszene, aus der der Kriminalroman FEINDE entstanden ist, der hier heute als bestes Debüt des Jahres 2018 ausgezeichnet wird.
„Etwas ist nicht geheuer. Damit fängt es an.“ Mit diesem Satz eröffnet Ernst Bloch seinen Essay über den Kriminalroman. Susanne Saygin war nicht nur ein Etwas nicht geheuer, sondern zwei.
Zunächst einmal war sie sich selbst nicht geheuer. Doch statt einem der gängigen Verdrängungsmechanismen zu verfallen, begann sie ihre Störung zu bearbeiten. In einem Selbsterklärungstext über die Entstehung des Romans setzte sie sich mit der Feindseligkeit auseinander, die sie ihren Nachbarn gegenüber empfand. Sie war für sie auf Dauer inakzeptabel. Zum einen wegen ihres eigenen Migrationshintergrunds – ihr Vater kommt aus Istanbul – zum anderen, weil sie spätestens während des Studiums gelernt hatte, dass persönliche Betroffenheit immer nur ein erster Ansatzpunkt für eine weitergehende und kritische Auseinandersetzung mit der Realität sein sollte.
Indem sie sich damit beschäftigte, was in ihrer Nachbarschaft vorging, stieß sie auf das zweite, das nicht geheuer war. Sie schreibt:
„Dazu gehörte (..) der Arbeiterstrich vor unserer Haustür. Viele der Männer aus dem Nachbarhaus standen schon im Morgengrauen vor dem Haus und warteten darauf, als Tagelöhner auf dem Bau Arbeit zu finden. (..) Wir haben dieses Thema wiederholt bei der Stadt angesprochen, ohne dass diese in erkennbarer Form aktiv geworden wäre. Dieses Stillhalten konnte ich mir lange nicht erklären. Irgendwann in dieser Zeit bin ich dann aber an einer Baustelle der öffentlichen Hand vorbeigekommen und habe dort einen unserer bulgarischen Nachbarn wiedererkannt. Und da hatte ich plötzlich einen Verdacht: Was, wenn die Stadt duldet, dass Menschen unter prekärsten Verhältnissen hier leben und sich illegal als Tagelöhner verdingen?“
Aus diesem Verdacht entstand der Kriminalroman.

(c) Random House/Anja Schäfer Photography
Das, was hier, in unseren den Armen und dem Elend aufgeschlossenen Kreisen, beinahe selbstverständlich klingt, war alles andere als selbstverständlich. Der Roman FEINDE ist ein Kind der Zivilcourage, seine Mutter ist die Empörung und sein Vater ist der Zorn. Die meisten Krimi-Debüts sind im Vergleich dazu Waisenkinder.
Am Beginn eines literarischen Debüts steht gewöhnlich eine persönliche Erschütterung: eine Liebe ist zerbrochen, eine Krankheit ist ausgebrochen, ein lieber Mensch ist verschieden. Der zukünftige Autor setzt sich nieder, beschreibt Trauma und Schmerz und sendet seine Arbeit an einen literarischen Nachwuchswettbewerb.
Von diesen verständlichen und ehrenwerten Betroffenheits-Artikulationen unterscheidet sich FEINDE grundsätzlich. Als Wissenschaftlerin – Susanne Saygin ist Historikerin, und wer ein Problem mit der Renaissance hat, kann sich immer an sie wenden – hat sie das, was die Herren Heil oder Altmeier die „Arbeitsmarktlage“ der Roma-Migranten nennen würden, gründlich untersucht und in persönlichen Augenschein genommen. In der Wissenschaft nennt man das Autopsie. Sie ist nach Bulgarien, nach Plovdiv und in die kleine Stadt Stolipinovo gefahren, sie hat sich die Hütten und Dörfer angesehen. Den sogenannten „Gazastreifen“, wo die „Zigos“, „die Schwarzen“ hausen, ebenso eingepfercht wie die Palästinenser im Gaza-Streifen.
„Palästinenser“ ist offensichtlich ein internationales Schmähwort für Unterprivilegierte, für den Bodensatz von Gesellschaften. In Bulgarien wie in Havanna. Dort heißen so die Arbeitsmigranten, die ohne Papiere aus dem armen Osten Kubas in die Hauptstadt eingewandert sind. Nachzulesen in Leonardo Paduras Kriminalroman DIE DURCHLÄSSIGKEIT DER ZEIT.
Hinfahren, hinschauen muss man, wenn man gute Kriminalliteratur schreiben will, sich buchstäblich der Scheiße aussetzen, nach denen diese Palästinenser-Zigo-Buden ohne Wasser und Strom stinken. Nur wer dort war, kann das im Roman „Fort Knox“ genannte Gebäude so beschreiben:
„Der NGO-Bunker in Stolipinovo. Früher waren die Hilfsorganisationen über das ganze Viertel verstreut. Das ist denen irgendwann zu heiß geworden. Also haben sie mit viel EU-Knete einen Betonklotz mit vergitterten Fenstern und Sicherheitskameras mitten ins Ghetto gestellt.“
Dorthin, wo die Zigos hergekommen sind, muss auch Saygins Kommissar Can Arat reisen. Um herauszufinden, wer einen ermordeten und geschändeten jungen Arbeitsstricher nach Köln geschickt hat und wie weit das Netzwerk der Arbeitssklaverei gespannt ist. Can, deutscher Kriminalbeamter mit türkischem Hintergrund und Sprachkenntnissen, operiert in Bulgarien selbst nur halb legal. Formell hat er Krankenurlaub. Nachdem der einzige Tatzeuge umgebracht und seine Kollegin massiv eingeschüchtert wurde, ist ihm der Boden in Köln zu heiß geworden. Er flieht vor Staatsanwälten und Bauunternehmern, die vom Arbeiterstrich profitieren. Can ist auf der Flucht vor Gangstern mit Seidenschal und vor einem Staatsapparat, der sie deckt, indem er die Gangster als Wohltäter auszeichnet.
TÖDLICHER KLÜNGEL hieß einer der allerersten Regio-krimis, erschienen 1985. Es scheint, als habe sich in mehr als 30 Jahren nichts geändert. Der kölsche Klüngel mordet wie eh und je. Was sich geändert hat, sind die Dimensionen: War damals der mörderische Klüngel noch auf das Rheinland beschränkt, hat es Can, und mit ihm hunderte von Arbeitssklaven, jetzt mit einer globalen Bande zu tun. Um überhaupt mit dem Leben davon kommen zu können, müssen Can und seine spröde Geliebte Isa ihre eigenen internationalen Kontakte mobilisieren. Manchem Leser und Kritiker war dieser Ausgang – die beiden finden Asyl weitab von Köln und Stolipinovo – zu positiv, ja kitschig.
Ich erinnere hingegen an Friedrich Schiller. Im Unterschied zur Satire, die die schlechten Seiten einer Situation überzeichnet, malt die Idylle ein harmonisches Gegenbild, um die ganz schlechten Zeiten umso deutlicher kenntlich zu machen. Dass Can und Isa überhaupt fliehen mussten, und wie ihre Flucht gelungen ist, sind Indizien für den verrotteten Zustand des Rechtsstaats. „Krimi kann alles“, sagt Jochen Vogt, Ziehvater der winzigen Sparte von deutschen Literaturwissenschaftlern, die sich mit Kriminalliteratur befassen. Krimi darf – und muss – auch überzeichnen. Was Susanne Saygin ganz unängstlich in ihrem Debüt getan hat.
Mit FEINDE hat sie sich auf ein wildes Terrain gewagt, sie ist den Feinden der Menschlichkeit mit gezückter Maushand entgegengetreten, hat sie klaren Blicks markiert – und hat gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch!
Meine Rezension in der ZEIT finden Sie hier

Schreibe einen Kommentar