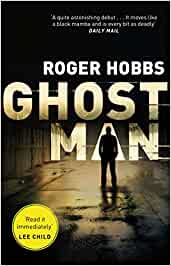
Hin und wieder versucht es ein junger Autor, in die Fußstapfen des großen Richard Stark zu treten, der in seinen Parker-Romanen noch ein vielleicht letztes Mal den einsamen, utilitaristischen Verbrecher als Fachkraft für Raub und Überfall verewigt hat. Eine caper–novel dieser Art ist aktuell Ghostman, dessen 24-Jähriger Autor Roger Hobbs von Talentsuchern bereits als Jünglings-Genie gehandelt wird.
Der Ghostman ist ein Fachmann für Fluchten, Vertuschungen, Täuschungen und für das Ungeschehen-Machen von Verbrechen. Der wichtigste Mann also, wenn man Großes vorhat und ungeschoren davonkommen will.
Letzteres gelingt den beiden Gangstern nicht, die – gut gedopt und perfekt im Timing – ein Casino in Atlantic City überfallen haben. Kaum haben sie die Fahrer des Geldtransporters umgenietet und den 12-Kilo-Klotz Frischgeld aus der Bundesbank an sich gebracht, stehen sie selber unter Beschuss: Einer stirbt, der andere kann schwer verletzt fliehen. Marcus Hayes, der jugmarker (man kann bei Hobbs eine Menge Fachausdrücke und technisches Zeug lernen) des Überfalls, schickt Ghostman Jack Delton los. Jack hat weniger als 48 Stunden Zeit, die Beute vor dem Zugriff der Polizei oder des konkurrierenden Drogenbarons vor Ort in Sicherheit zu bringen. Denn in dem plastikverschweißten Packen mit 1,2 Mio Dollar (die Zeiten der mythischen Milion sind vorüber) steckt eine Bundesbeiladung. Das ist ein Sprengsatz, der nach einer programmierten Frist das Geldpaket in die Luft pustet und eine Spur schafft, die sogar der dümmste Polizist nicht übersehen kann. Ghostman hat einen Job in Kuala Lumpur vermasselt und steht in Hayes Schuld.
Wie er sich auf der schmalen, halb versumpften und halb verrotteten Landzunge durchmogelt und -mordet, ist schon prima gemacht, vor allem die Konfrontation mit dem lokalen Druglord „Wolf“, der seine Feinde gerne mal ein Pfund Muskat runterwürgen und daran krepieren lässt, ist nicht schlecht choreografiert. Aber Hobbs gelingt es nicht, wirklich Interesse für Ghostmans Davonkommen zu wecken. Dafür ist der Kerl zu kalt und zu perfekt. Sein Hobby, das Übersetzen aus dem Lateinischen, wirkt als Charakter-Accessoire übertrieben, und wenn Ghostman bekennt, er wolle der Langeweile Ovids durch Action entkommen, dann klingt das genau so: als Statement für die Kulisse. Zudem wird Ghostmans Part aus der Ich-Perspektive erzählt, was rein erzähltechnisch seine Überlebenschancen auf 100 % bringt.
Kurz, trotz Lee Childs Lob für das Debüt des 24-jährigen Autors Hobbs: Richard Starks Parker war unter anderem deshalb so gut, weil er nur halb so viel geredet und mehr nachgedacht hat. Ich bin gespannt, wohin sich Hobbs entwickelt. In Richtung Greg Iles, der nach einem beachtenswert spannenden Debüt zum Pageturn-Plotter wurde, oder doch zum Nachfolger – wenn schon nicht Starks, dann vielleicht Lee Childs?
Roger Hobbs: Ghostman
Deutsch von Rainer Schmidt; Goldmann, 384 Seiten
