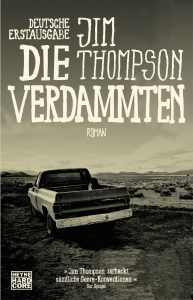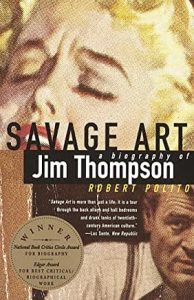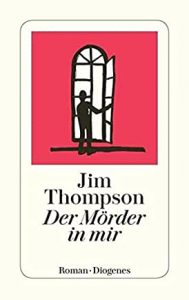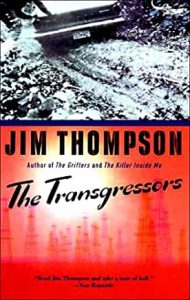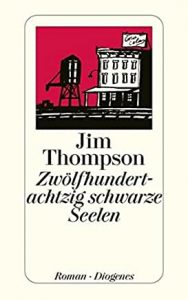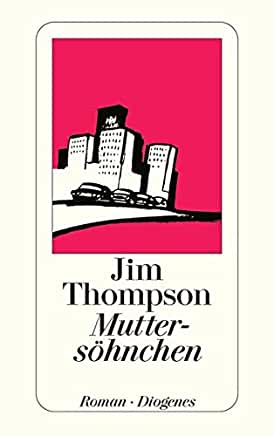Nachwort zur deutschen Erstausgabe 2014
Jim Thompson eröffnet seinen neunzehnten Roman, als würde er noch einmal ganz von vorn anfangen.
Kein mörderischer Sheriff beginnt einen rasenden Monolog, der in Wahn und Mord endet, kein Räuber wird vom Portier geweckt und bricht auf, um eine Bank zu knacken.
Statt dessen Landschaft, so weit das Auge reicht: „Das riesige Cabrio schaukelte gemächlich unter dem texanischen Himmel dahin, der an diesem Nachmittag Ende August hier im äußersten Westen ein blasses, vom Wind leer gefegtes Blau angenommen hatte. Es kroch auf den Horizont zu wie ein großer schwarzer Käfer in einer umgestülpten Glasschüssel…“
Und im folgenden Abschnitt wird Thompson für seine Verhältnisse geradezu lyrisch:
„Der Wind blies beinahe gleichmäßig, was man nur bemerkte, wenn er zwischenzeitlich nachließ. Die spärlichen Halme des sonnenversengten Johnson-Grases neigten sich unter seiner Kraft fast flach auf die Erde, und die hoch aufragenden Kakteen, die baumhohen Palmlilien bogen sich wachsam aus seiner Bahn. Der Wind schien es darauf anzulegen, rastlos alles vor sich her zu fegen, bis die Verwüstung komplett war.“
Beiläufig streift der Blick des Erzählers die beiden Personen in dem Cabrio und notiert, als wisse er noch nicht recht, was er mit ihnen anfangen soll: „eine Prostituierte und ein Deputy Sheriff“. Versierte Thompson-Leser vermuten, dass die beiden nicht allein bleiben werden, bei diesem Autor hat der einsame Mann mindesten zwischen zwei, manchmal auch drei Frauen zu wählen. Und wer weiß, wie viele von ihnen am Ende noch am Leben sein werden. Aber erst einmal werden die beiden durch das Ruckeln des Wagens zusammengedrängt.
*
Jim Thompson schrieb „Die Verdammten“ 1960. Er war 53 Jahre alt und hatte kurz zuvor einen ersten Schlaganfall erlitten. Sein Biograph Robert Polito rekapituliert, dass Thompson seit seiner Highschoolzeit täglich mehr als zwei Schachteln Zigaretten geraucht, schwer getrunken und seit etlichen Jahren Amphetamine genommen hatte, um sich aufzuputschen. Glücklicherweise war nur vorübergehend die Funktion seiner rechten Hand beeinträchtigt. Stanley Kubrick, für den er als Drehbuchautor arbeitete, zahlte ihm generös den wöchentlichen Scheck über 300 Dollar weiter, während Thompson in drei Monaten Physiotherapie seine manuelle Schreibfähigkeit wieder erlangte. Von einer Freundin seiner Tochter, der er seine Texte diktierte, ist die Bemerkung überliefert: „Ich kann nicht glauben, dass dieser nette alte Herr derart (schweinische) Worte kennt!“
*
Kein Roman Thompsons entstand unter so verworrenen und schwierigen Bedingungen wie „Die Verdammten“. Er war eine Auftragsarbeit. Ursprünglich sollte der Roman „Cloudburst“ heißen nach dem Drehbuch für einen Film, der nie produziert wurde und als Vorlage diente.
Der wüste Western-Stoff sollte als Novelization durch Thompson noch eine Verwertungschance bekommen. Thompson war damals in Hollywood und in der New Yorker Verlagsszene ein respektierter Mann.
Im Gerangel zwischen Verlegern, Geldgebern, Filmproduktion, Agenten und Autor Thompson wurde die wilde Ursprungsstory um schwedische Goldgräber, betrogene Farmer, Outlaws und eine Frau, die den Mörder ihres Mannes sucht, in Liebe zu ihm verfällt und ihn trotzdem erschießt, zunächst nach Nordafrika verlegt. Ins Zentrum eines von Thompson konzipierten, überlieferten Exposés ist ein Mann gerückt, der ausschließlich an sich selbst denkt. Nachdem die Frau auf ihn geschossen hat, päppelt sie ihn reumütig wieder auf, ohne sich sicher sein zu können, ob er sie liebt oder lieben kann. Auf die Frage, ob sie umgekehrt imstande ist, ihn zu lieben, findet Thompson eine für ihn typische Lösung: „Weil sie ihn lieben könnte, muss sie ihn töten. Sie muss es tun, weil sie ihn tatsächlich liebt. Ende der Geschichte.“ Im titelgebenden Wolkenbruch.
Kaum war der Vertrag über 3000 Dollar unterschrieben, setzte sich Thompson an den Schreibtisch und warf beinahe alles, was verabredet war, über Bord. Die Handlung verlegt er in die Öl-Boomtown Big Sands nach West-Texas zurück, die wirtschaftliche Intrige spielte statt unter Ranchern auf dem modernen Feld der Ölförderung, auf dem sich Thompson durch eigene Erfahrung als Ölarbeiter bestens auskannte. Und der smarte, schillernde Mann im Zentrum wurde nach einem alten Bekannten benannt: Lou Ford.
Lou Ford – so hieß auch der Deputy Sheriff, der in „The Killer Inside Me“ von 1952 unter der Maske des wohlwollenden Trottels zum mehrfachen Mörder wird und im religiösen Wahn endet. Lou Ford – das war auch der Chief Deputy Sheriff, der in „Wild Town“ von 1957 die komplizierte Intrige zweier Prostituierter zur Ermordung eines Ölbarons vereitelt.
Bevor „Cloudburst“ gedruckt wurde, brach bei Thompson ein Magengeschwür durch. Er verlor so viel Blut, dass er beinahe starb. Das Krankenhaus in Los Angeles, wo er wegen der Nähe zur Filmindustrie wohnte, wollte den Todkranken zunächst nicht aufnehmen, weil er weder Geld noch eine Krankenversicherung hatte.
Als er wieder entlassen war (zufällig am Tag der Inauguration von Präsident Kennedy 1961), musste Thompson noch einen Streit um den Titel „Cloudburst“ ausfechten, der ihm nicht gefiel und nach mehreren Verhandlungen mit den Rechteinhabern und dem Verlag mehr oder minder zufällig mit der Entscheidung für „The Transgressors“ – in der deutschen Bedeutung schwankend zwischen „Grenzüberschreiter“ und „Übeltäter“ – entschieden wurde.
Kurz vor Drucklegung ließ Thompson dann den Namen „Lou Ford“ in „Tom Lord“ ändern. Er fürchtete Komplikationen wegen der für diese Figur und die früheren Romane bereits vergebenen Filmrechte. Als „The Transgressors“ 1961 nach diesen Qualen und Querelen endlich herauskam, betrachtete Thompson es in neugewonnenem Selbstbewusstsein als „Meilenstein“ in seiner literarischen Entwicklung und gab es als sein fünfundzwanzigstes Buch aus. Damit schien er dem Ziel, ein „Verfasser von mehr als fünfzig Romanen“ zu werden, schon ein Stück näher gekommen. (Er würde es bis zu seinem Tod 1977 auf dreißig Romane bringen.)
*
„Es gibt zweiunddreißig Arten eine Geschichte zu schreiben, aber es gibt nur einen Plot: Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen.“
Thompson liebte es, diesen Satz zu zitieren. Seine Studenten der Creative Writing Class an der University of South California kannten ihn vermutlich auswendig.
Dem österreichischen Schriftsteller Antonio Fian, der nur Lou Ford I und II kannte, kam es bereits so vor, „als habe man zwei verschiedene Rollen mit demselben Darsteller besetzt.“
Der dann, im Falle von Lou Ford bzw. Tom Lord recht wandlungsfähig sein muss. Der Lou Ford I des „Killer inside me“ hält sich, bevor er in seinem brennenden Haus umkommt, für eine Inkarnation von Jesus und dem Teufel – offen bleibt aber, ob es sich nicht bei dem Wahn nicht doch um das handelt, was Tom Lord (Ford III) „seine unaufhörlichen Rationalisierungen“nennt. Nach seinem Feuertod in „Central City“ taucht Lou Ford II – smarter, besser gekleidet, mehr Gentleman – in „Ragtown“ wieder auf, auch dies eine Öl-Stadt im Westen von Texas. Hier, in „Wild Town“ spielt er fast den klassischen Gesetzeshüter. Da er gut gekleidet ist, hält ihn der Ex-Knasti McKenna, aus dessen Perspektive fast alles erzählt wird, für einen korrupten Bullen mit Mordplänen. Tatsächlich gibt sich Ford einen dubiosen Anschein, um hinter dieser Fassade den Mordanschlag zweier Prostituierter auf den starken Mann am Ort zu vereiteln.
Auch in „Die Verdammten“ erweckt der nunmehr Tom Lord genannte Chief Deputy den Anschein des Zweifelhaften. Bis zum romantischen Schluss „in der unglaublichen, herzzerreißenden Schönheit der Nacht“ schwankt der Leser mit Donna McBride, ob es sich bei ihm nun um einen edelmütigen „Lord“ handelt oder um einen echten Ford, dessen wüsteste und erschreckendste Ausprägung der „Mörder in mir“ war.
Thompson hat dem Totschläger Tom Lord nämlich halbwegs akzeptable Motive beigegeben. Der Bohrmeister McBride, den er in einer Prügelei mit einem gezielten zweiten Schuss ermordet, hat ihn unter dem Druck seiner Mafia-Hinterleute betrogen. Und den Ölarbeiter Red Norton überfährt er in Notwehr.
Auch Lords eher angedeutetes problematisches Innenleben ist weitaus weniger dämonisch als das seiner Vorgänger. Lord präsentiert wie sie eine öffentlich Fassade. Aber sie ist keine bewusste Tarnung wie bei Ford I, der den Trottel markiert, um den Killer in sich unter Kontrolle und vor der Öffentlichkeit verborgen zu halten. Noch ist sie Ausdruck einer Mischung von Einsamkeit, Bindungsunfähigkeit und Professionalität wie bei Ford II. Lord ist sich selbst unheimlich, er glaubt, unter Zwängen zu handeln. Sein (Selbst-) Porträt trägt Züge pubertärer Unsicherheit:
„Er sah aus wie jeder andere hier draußen. Redete wie sie. Benahm sich wie sie. War wie sie, abgesehen von dem, was in seinem Inneren vorging. Und genau das war, wenn man der Sache auf den Grund ging, das Entscheidende. Es war das, was ihn lieben oder hassen ließ, selbst sterben oder töten ließ. Allerdings wusste niemand davon, niemand konnte sein Handeln entschlüsseln oder vorhersagen. Und mit Sicherheit konnte er es nicht, zwanghaft getrieben wie er war.“
Das unvorhersehbar Zwanghafte tritt nur selten, dann aber deutlich und durchaus verwandt mit den Zwängen und Lüsten von Ford I (und denen der vierten dämonischen Sheriff-Figur Thompsons: Nick Corey, Antiheld von „1280 schwarze Seelen„) hervor: als Sadismus.
Bevor Lord den Bohrmeister Aaron McBride erschießt, verprügelt er ihn so, dass er danach ein gebrochener Mann ist. Hier springt gewissermaßen der Teufel hervor aus dem Getue des Mannes aus alter Familie, der sich nur notgedrungen gemein macht mit den Kuhtreiber-Deputies. Im Schutz der Dienstmarke kann und darf er demonstrieren, dass er kein Schwächling ist und dass er nur aus Überlegenheit, nicht aus Arroganz, darauf verzichtet, eine Waffe zu tragen. Noch teuflischer praktiziert der Sadist als „Faksimile eines Arztes“: In der extrem bösartigen Szene, in der er die betäubte Donna, die eben mit Kaiserschnitt entbunden wurde sowie Mann und Baby verloren hat, in einem Akt verführt, erniedrigt, entkleidet und missbraucht.
*
Noch etwas anderes haben Ford II und Lord miteinander gemein: den Landbesitz und die Familie.
Am Beispiel der „Königlich Spanischen Landschenkung“ kann man den sparsamen Umgang des versierten Lohnschreibers Thompson mit einem Motiv studieren. In „Wild Town“ ist der Besitz großer Ländereien die Quelle von Fords Wohlstand (und nicht die Korruption, wie McKenna in seinem primitiven Neid vermutet). Ein paar Jahre später ist der Landbesitz Quelle von Lords Kränkung und Beinahe-Untergang.
Der Wechsel von Boom und Depression, von Reichtum und scharfer Entbehrung ist der Rhythmus der Ölwirtschaft. „Ein See aus Öl kann genauso gut austrocknen wie jeder andere See auch.“ In dieser lakonischen Feststellung des Erzählers in „Wild Town“ ist nicht nur die Geschichte der US-amerikanischen Energiewirtschaft auf den Punkt gebracht, sondern auch die Familiengeschichte der Thompsons. Jim Thompsons Vater James Sherman Thompson hatte es in Fort Worth (der kaum kaschierte geographische Bezugspunkt in allen West-Texas-Romanen des Sohnes) zum Ölmillionär gebracht. Allzu gierige Ölförderung bei mangelnder Kapitaldeckung, sinkende Preise, Gutgläubigkeit und die Ermordung des Hauptinvestors und Partners durch seine Geliebte ruinierten Vater Thompson so sehr, dass er 1921 bankrott ging.
(Die Witwe und Erbin des ermordeten Compagnons diente, so ist zu vermuten, der „Hexe“ in den „Verdammten“ zum Vorbild, die „Highlands bis zum letzten Fass und zur letzten Schraube besaß und beherrschte“.) Sohn Jim war 15 und musste von da an seine Mutter, seine Geschwister und später auch den verarmten, kranken und hospitalisierten Vater ernähren.
All die Fords, Lords und Coreys in Thompsons Werk können bei aller Vorsicht vor den Missdeutungen einer psychologisierenden Lektüre als Alter Egos des angehenden Schriftstellers gelesen werden, der in den Nächten und seltenen Pausen für Unterhaltungsblätter und True-Detective-Magazine Zeilen schrubbte, zur Schule ging, studierte und dabei als Ölbohrer, Botenjunge, Schmuggler, Sprengstoffexperte und Lagerhalter in der Luftfahrtindustrie schlechtes Geld verdiente. Alle spielen Männer, die sich unterhalb ihrer intellektuellen Möglichkeiten mit der Mittelmäßigkeit der Provinz arrangiert und in untergeordneten Jobs eingerichtet haben. Dieser tagtägliche Kampf ums Überleben und die nächste Flasche war keineswegs so romantisch, wie die Klappentext-Biographien Thompsons suggerieren.
Produkte romantischer Überhöhung sind aber auch die von Thompson erdachten ins 16. Jahrhundert zurückreichenden Stammbäume der Fords und Lords samt ihren großen leeren Holzhäusern, in denen Generationen von Ärzten immer eine offene Tür für ihre Mitmenschen hatten. Thompsons Herkunft ist die schlichter Einwanderer, und er selbst hat nie ein Vermögen besessen, sondern hat sich, bis er das Alter seiner Protagonisten erreicht hatte, mit erniedrigender entfremdeter Arbeit und quälenden Geldnöten herumgeschlagen.
Tatsache ist, dass Thompson erst 1941 im Alter von 35 Jahren der Ausbruch aus dieser Enge gelang und er in wenigen Wochen seinen ersten, autobiographischen Roman „Now and on Earth“ schreiben konnte, der ihm auch endlich etwas Anerkennung einbrachte. Bezeichnenderweise geschah dies quasi unmittelbar nach dem Tod seines übermächtigen Vaters. Thompson verfasste in dem selben Roman eine dem berühmten Brief Kafkas an Wut und Verzweiflung kaum nachstehende Anklageschrift gegen den verstorbenen Tyrannen, die – typisch für Thompson, der Harmonie meist als Unterwerfung verstand – in rührseliger Anbiederung ausklingt.
Ausbrechen, Wegziehen, Abhauen – das ist ein durchgehendes Motiv in Thompsons Romanen. Es gelingt nie. Thompsons West-Texas, als amerikanischer Literaturraum durchaus mit dem Yoknapatawpha County seines Vorbilds Faulkner vergleichbar, ist ein geschlossenes System, aus dem es kein Entrinnen gibt.
Es ist eine aus Hochmut und Versagensangst, Auftrumpfen und Abducken, hellstem Durchblick und existenzieller Handlungsunfähigkeit bestimmte Binnenwelt, deren Helden Antonio Fian an Becketts Figuren erinnern: „Ihr Scheitern ist außer Frage gestellt, und ihr Tod ist ihnen selbst Erlösung: Nur ein angeborener Instinkt zu überleben, dem ohne Tricks nicht beizukommen ist, hat ihn so lange hinausgezögert. Sie sind Selbstmörder, die auf fremde Hilfe angewiesen sind.“
*
Und diese Selbstmörder-Mörder sind immer Männer. Zwar sind sie umlagert, bedrängt und sogar angebetet von einem Haufen Frauen. Aber all diese Joyces – das ist Thompsons Berufsvorname für die Nutten – und Amys – so heißen die Lehrerinnentypen – kennen nur zwei Varianten von Verhalten: Unterwerfung, die masochistische Lust durchaus einschließt, und/oder Tyrannei. Daher liegt es voll im Muster Thompsonscher Misogynie, wenn in den „Verdammten“ die Nutte Joyce ihren Heiratsvorschlag als Versprechen von Freiheit durch ewige Gefangenschaft formuliert: „‘Wir sollten besser schnell heiraten, Tom. Eine Frau kann nicht gegen ihren Ehemann aussagen.‘“ Diese potenzielle Freiheitsberaubung durch Heirat empfindet Lord als so bedrohlich, dass er cool erwidert: „‘Da gibt’s noch was, was eine Frau nicht kann.‘ ‚Was?‘ ‚Sie kann nicht aussagen, wenn sie tot ist.‘“ Kein Wunder, dass die Leser vermuten, Lord habe Joyce umgebracht.
Wie immer in Thompsons schwarzem Werk kippelt in den „Verdammten“ das Bild zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Aber erstaunlicherweise und – meines Wissens auch nur hier – nicht in Richtung Düsternis und Einsamkeit. Was auch immer dahinterstecken mag – eine vorübergehende Aufhellung von Thompsons persönlicher Situation, der banale Optimismus einer Hollywood-Drehbuchvorlage, die fragwürdige Konstruktion einer Frauenfigur, die sich in den Mörder ihres Mannes verlieben soll – das sternenbeschienene Ende des Romans wirkt nicht völlig willkürlich herbeigeordert. Es ist durch die merkwürdigen Gefühlsschwankungen Donnas zwischen Hass und Zuneigung vorbereitet. Und als Lord einmal von der Chance eines neuen Tages spricht, kann man annehmen, dass dies nicht nur ein übler Trick ist, um Donna auf seiner Seite zu halten. Zwischen dem ultraschwarzen Finish, das im Exposé zu „Cloudburst“ vorgesehen war, und die Realisierung in den „Verdammten“ hat sich ein Hauch Lebensvertrauen in Thompsons Werk geschlichen. Ist das ein Grund dafür, dass er selbst den Roman für einen neuen Anfang hielt?
In den auf „Die Verdammten“ folgenden Werken ist Thompson wieder in die vollständig Düsternis des Noir zurückgekehrt, die ihn zum Solitär unter allen Kriminalschriftstellern des zwanzigsten Jahrhunderts gemacht hat. Auf „The Transgressors“ folgten mit „The Grifters“ und „Pop. 1280„ zwei der schwärzesten Romane, die Jim Thompson geschrieben hat.
Dieses Nachwort ist minimal verändert ein Originalbeitrag zu der Erstübersetzung von „The Transgressors“ aus dem Sommer 2014.
Jim Thompson: Die Verdammten
Aus dem Englischen von Gunter Blank und Simone Salitter
Heyne Hardcore, 306 Seiten